Vor 150 Jahren veränderte eine Reise durch die Schweiz die touristische Welt: Die britische Reisegruppe von Thomas Cook, die 1863 die Schweiz bereiste, war nämlich die allererste, die mit einer organisierten Gruppenreise unterwegs war — der Gruppentourismus war erfunden. Drei Reiseberichte und eine Buchkritik.
Dieser Eintrag hat eine längere Geschichte: Als ich im Sommer die
4-Seen-Wanderung verblogte, die z.T. auf der Via Sbrinz verläuft, landete ich wieder einmal auf der Homepage von Kulturwege Schweiz, wo ich feststellte, dass es neben der Via Sbrinz auch eine
Via Cook und zehn weitere geschichtsträchtige Routen auf historischen Wegen gibt:
 Die 12 Routen von Kulturwege Schweiz (zum Vergrössern Karte anklicken!
Die 12 Routen von Kulturwege Schweiz (zum Vergrössern Karte anklicken!

Doch so richtig angesprungen hat mich diese Geschichte ein paar Tage später, als im Radio SRF 4 News eine halbstündige Zeitblende zum 150. Jubiläum der ersten Gruppenreise von Thomas Cook kam. Die Sendung mit dem Titel
Auf den Spuren von Thomas Cook und Jemima Morell basierte auf einem Gespräch mit Diccon Bewes, einem Engländer, der in Schweiz lebt und ein Buch über diese erste Gruppenreise für Oktober ankündigte. Auf seinem
Blog schreibt er immer wieder über die Schweiz, ihre BewohnerInnen und ihre Eigenheiten — ein oft witziger Blick von aussen. In seinem Buch
Slow Train to Switzerland vergleicht er Cook's Reise von 1863 mit den eigenen Erfahrungen, die er 150 Jahre später auf der selben Route machte.
Reise 1: Miss Jemima's Abenteuer des Lebens

 Jemima Morell 1863. Bild: www.srf.ch. Thomas Cook's Reisegruppe — Miss Jemima ist die Dritte von links. Bild: www.kulturwege-schweiz.ch.
Jemima Morell 1863. Bild: www.srf.ch. Thomas Cook's Reisegruppe — Miss Jemima ist die Dritte von links. Bild: www.kulturwege-schweiz.ch.
Ich weiss nicht, ob Jemima Morell sich bewusst war, dass sie sich auf das Abenteuer ihres Lebens einliess, als sie 1863 bei Thomas Cook kurzfristig die Gruppenreise in die Schweiz buchte. "Thomas Cook's first Conducted Tour of Switzerland" war nämlich die erste Gruppenreise ausserhalb Grossbritanniens und als Testreise konzipiert, die mit heutigen Pauschalreisen kaum zu vergleichen ist. Reisen war damals noch äusserst beschwerlich und anstrengend, weil vom schweizerischen Eisenbahnnetz erst die Hauptlinien durchs Mittelland fertiggestellt worden waren und die meisten Pass-Strassen erst in jener Zeit entstanden. Der Saumweg über den Brünig z.B. wurde 1857 - 1860 zur fuhrwerktauglichen Strasse ausgebaut. So war die siebenköpfige Gruppe von Miss Jemima viel zu Fuss unterwegs und überquerte zwei Alpenpässe mit Hilfe von Maultieren. Das grösste Abenteuer war aber wahrscheinlich die Überquerung des Mer de Glace in Chamonix mit aus heutiger Sicht höchst fahrlässiger Ausrüstung:

Das Bild aus den Beständen der Zentralbibliothek Zürich zeigt die Traversée de la Mer de Glace. Bild: upload.wikimedia.org
Auch die Hotelübernachtungen musste die Gruppe teilweise selber organisieren. So glich Miss Jemima's Reise durch die Schweiz mehr einem Rucksacktouristen-Trip mit organisierter Hin- und Rückreise als einer durchorganisierten Pauschalreise. Durchaus vergleichbar mit heutigen Schweizreisen waren die Aufenthaltszeiten an den Etappenorten: Für die Sehenswürdigkeiten in Luzern hatte die Gruppe von Miss Jemima gerade mal vier Stunden Zeit...
Dass man so viel weiss über Thomas Cook's erste Gruppenreise verdanken wir der Tatsache, dass Jemima Morell ein Reisetagebuch führte, und der Tatsache, dass dieses Tagebuch in den Trümmern eines im Zweiten Weltkrieg zerbombten Londoner Hauses wieder entdeckt und 1963 anlässlich des 100-Jahre-Jubiläums publiziert wurde.

Das Bild aus dem Archiv von Thomas Cook zeigt zwei Tagebuchseiten aus Miss Jemima's Swiss Journal. Bild: Englischer Beitrag auf dem Newsportal der Deutschen Welle
Reise 2: Diccon Bewes auf Miss Jemima's Spuren
Auf seiner Rekonstruktion von Miss Jemima's Reise durch die Schweiz ist Diccon Bewes im selben Rhythmus unterwegs und übernachtet an den selben Etappenorten wie Cook's Reisegruppe, aber er hält sich nicht sklavisch an Jemima's Swiss Journal und macht auch mal einen "ear-popping, jaw-dropping" Ausflug auf die Aiguille du Midi — etwas, das zu Jemima's Zeiten undenkbar gewesen wäre. Auch die Transportmittel sind nicht immer die selben: Während Miss Jemima mit Postkutsche und Dampfschiff von Brienz über den Brünig nach Luzern gelangte, sind Bewes und seine Mutter mit dem "slow train" der Zentralbahn unterwegs. Während Bewes' TGV mit 250 km/h von Paris nach Genf rast, waren für Miss Jemima schon die 30 Stundenkilometer, mit denen sich ihr Zug 1863 fortbewegte, schon fast zu schnell.
Zum Teil ist das Reisen auf der selben Route wieder komplizierter geworden: Um die Morgenfähre von Newhaven nach Dieppe zu erreichen, muss Bewes an der Kanalküste übernachten, weil es keine direkte Zugsverbindung von London nach Newhaven mehr gibt. Und in Dieppe konnte man früher an der Station maritime vom Schiff auf den Zug umsteigen, heute fährt einem der Shuttlebus am Fährterminal vor der Nase ab...

Während Miss Jemima sich über die Kurgäste mokierte, die sich in Leukerbad tagelang einweichen liessen, geniesst die Jubiläumsreisegruppe 150 Jahre später das "schwimmende" Frühstück. Bild: Blogeintrag A Swiss tour to remember von Diccon Bewes
Der Vergleich der beiden Reisen liefert interessante Erkenntnisse über Gemeinsamkeiten und Unterschiede beim Reisen, über die Schweiz von damals und heute und über die Entwicklung des Tourismus und der touristischen Infrastruktur. Im Vorwort stellt Bewes drei Thesen auf, die er mit seinem Sachbuch belegen will: Es war 1. eine Tour, die die Welt des Reisens veränderte, 2. eine Reise, die den Massentourismus einläutete, und 3. eine Invasion, die die moderne Schweiz kreierte. Während die ersten beiden Thesen dank vielen Fakten nachvollziehbar werden, habe ich bei der dritten These so meine Zweifel: Möglicherweise war die britische Touristeninvasion ein Treiber für den Modernisierungsschub in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, aber nicht der einzige und schon gar nicht dessen Ursache. Viel wichtiger war die Bundesstaatsgründung von 1848.

Das Dampfschiff Rigi, das 1848 in London gebaut wurde und heute im Verkehrshaus der Schweiz zu besichtigen ist, beförderte 1863 höchstwahrscheinlich auch Cook's Reisegruppe. Bild: Verkehrshaus der Schweiz
"Slow Train to Switzerland" ist ein Lobeshymne auf das langsame Reisen, aber Bewes hält uns Schweizern auch ein bisschen den Spiegel vor: "This is Swiss bliss" — "Das ist Schweizer Glückseeligkeit", schreibt er auf Seite 158:
"As the paddle steamer surges forward, cutting a swathe through the water, a welcome breeze tickles our faces and laps at the edges of the giant Swiss flag dangling from the flagpole. This is Swiss bliss. It would be hard to find a more inherently relaxing hour than sitting in one of these Belle Époque beauties, surrounded by polished wood and brass, in turn surrounded by shimmering water and mountains. This is slow travel at its finest. We can sit back and relax until we reach the tourist capital of Switzerland, also known as Interlaken."
Obwohl ich die Schweiz gut kenne, habe ich dank Bewes dazugelernt: Nicht nur im Glarnerland gibt es ein
Martinsloch, sondern auch im Berner Oberland. Durch das Loch in der Eigerflanke scheint — wie in Elm (GL) — zweimal pro Jahr die Sonne genau auf die Kirche von Grindelwald (vgl.
Vom Martinsloch zum Gletschersee-Stollen in der Jungfrauzeitung vom 17.1.2013). Viele Stories und Anekdoten aus 150 Jahren Tourismus-Geschichte reichern die beiden Reiseberichte an und machen das Buch auch für Schweizer LeserInnen interessant.
Reise 3: Mit Google Earth auf Miss Jemima's Spuren
Mein Englisch ist nicht so gut, dass ich nie etwas nachschlagen müsste. Und mit dem virtuellen Wörterbuch auf
dict.leo.org geht das einfacher, schneller und besser als mit einem realen Diktionär. Deshalb las ich Diccon Bewes' Buch mit laufendem Laptop nebendran. So war es naheliegend, dass ich die Reisen von Jemima Morell und Diccon Bewes virtuell nachvollzog. Mit Google Earth folgte ich im Tiefflug der Bahnlinie von Dieppe nach Paris und gelangte schneller als der TGV nach Genf. Mit Google Street View spazierte ich durch Chamonix und schaute mir das Hotel Royal an, wo Thomas Cook's Reisegruppe 1863 zwei Nächte verbrachte:
 Der Screenshot von Google Street View zeigt das in ein Casino umgewandelte Hotel Royal in Chamonix.
Der Screenshot von Google Street View zeigt das in ein Casino umgewandelte Hotel Royal in Chamonix.
Sicher eine halbe Stunde, wenn nicht länger, wandelte ich virtuell durch die Räumlichkeiten und die Parkanlage des
Grandhotel Giessbach, wo Diccon Bewes und seine Mutter stilvoll nächtigten:
 Zum Start des interaktiven 3D-Rundgangs durch die grandiosen Räumlichkeiten des historischen Grandhotels am Brienzersee auf das Bild klicken!
Zum Start des interaktiven 3D-Rundgangs durch die grandiosen Räumlichkeiten des historischen Grandhotels am Brienzersee auf das Bild klicken!
Allerdings: Als Miss Jemima hier nächtigte, stand das vom berühmten französischen Hotelbauer Horace Edouard Davinet konzipierte Hotel noch nicht — der Hotelpalast mit Turmkuppeln "à la Louvre" öffnete erst 1875 seine Tore. Auch die Giessbachbahn, die älteste noch betriebene Standseilbahn der Schweiz, die von der Schifflände am Brienzersee zur Hotelanlage hinaufführt, nahm erst 1879 ihren Betrieb auf. Und: Als Miss Jemima 1863 hier ankam, war die Pension Giessbach, die heute als Personalhaus dient, ausgebucht und ihre Gruppe musste/durfte in einem zum Hotel gehörenden Chalet übernachten.
Hier Thomas Cook's first Conducted Tour of Switzerland im Schnelldurchlauf mit Google Earth (in 3:54):

Zum Start der Google-Earth-Tour auf das Bild klicken! Mit dem Control-Panel unten links lässt sich die Tour jederzeit anhalten, mit dem Klick auf die gelben Marker erscheinen Zusatzinformationen zu Miss Jemima's Schweizreise (mit Rechtsklick verschwinden sie wieder). Ist die Tour einmal unterbrochen, kann man sich mit der Google-Earth-Steuerung am rechten Rand umschauen und das Panorama geniessen.
Das Gute an Google Earth: Es ist immer schönes Wetter, der Himmel blau und die Aussicht grossartig. Und man kann gefahrlos abheben.


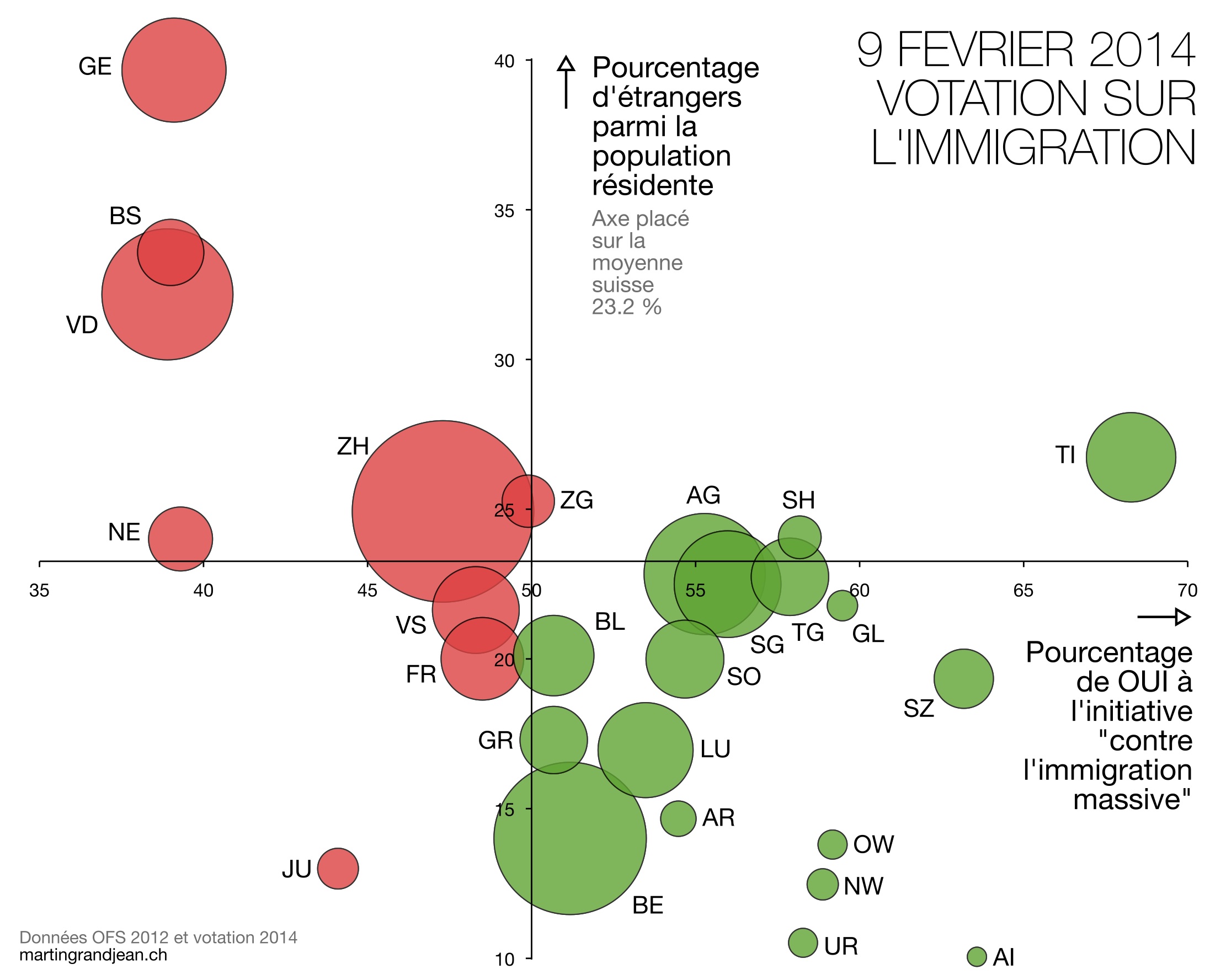












 Jemima Morell 1863. Bild:
Jemima Morell 1863. Bild: 


